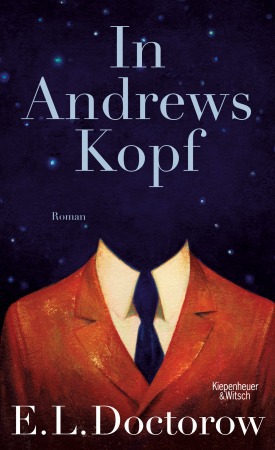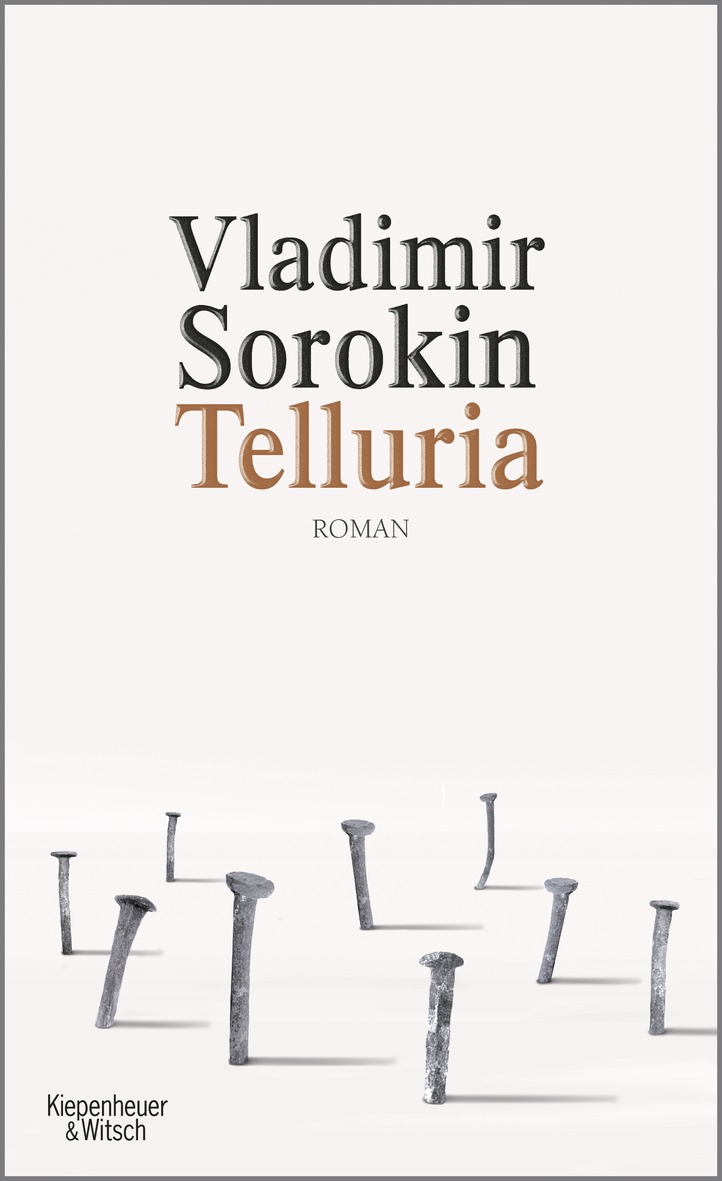Bea Dieker wurde 1960 im Münsterland geboren. Sie studierte Visuelle Kommunikation und ist als Künstlerin tätig. „Vaterhaus“ ist ihr erster Roman.

Anfangsschwierigkeiten
Was da als Roman daherkommt, machte es mir zunächst schwer, hineinzufinden. Adjektivlastige, oft nur aus einem, zwei oder drei Worten bestehende Sätze, merkwürdig gedrechselte Formulierungen („Formen und Farben, die mir die pastellige Verheißung eines unbeschwerten, fröhlichen Lebens entgegenwehten“, S. 7), komplizierte, oft nicht nachvollziehbare Beschreibungen des Interieurs („Hohe, sanft geschwungene Theke, besetzt mit strengen, vertikal verlaufenden, vor- und zurückspringenden Leisten… die gelben nach vorn herausstehend, die schwarzen sich mit ihrem hinteren Platz bescheidend“, S. 8) sowie ungebräuchliche Formulierungen („setzte meinen Atem still“, S. 9) und merkwürdig unpassende Adjektive („keusch gemusterte Kittelschürze“, S. 21), ebenso Wortneuschöpfungen („asthmagelb“, „Nuschelfarben“ S. 30/31) ließen immer meinen Lesefluss stocken.
Thema?
Noch auf S. 26 war mir nicht klar, warum mich die Erinnerungen dieser Frau interessieren sollten. Es war mir, als sähe ich ein altes Fotoalbum an mit Menschen, die mir völlig unbekannt sind. Keine Geschichten hinter den Menschen. Der Großvater war im Krieg? So what? Das waren Millionen andere auch. Nicht mal da etwas, das aus dem Einheitsbrei heraussticht. Eine Aneinanderreihung von Worten: „Plötzlich in großer Mission unterwegs. Auf großer Fahrt. Abenteuer. Bedeutung. Ausland. Mittendrin. Fremde Sprachen. Fremde Gesichter. Fremde Gefahr. Russland. Gefangennahme.“
Erst auf S. 27 scheint etwas durch, was mich interessieren könnte. Die Protagonistin hockt sich hinter die Tür und kackt. Und taucht die Füße ihrer Puppe in den Haufen, um damit die Tapete zu „bemalen“. Nach dem Geschrei der Mutter das Resümee: „In diesem Moment begann ich, eine klammheimliche und hartnäckige Missachtung zu entwickeln für alles, was je aus mir hervorkommen sollte.“ Doch im weiteren Verlauf des Buches erfährt man dazu nichts mehr.
Auf S. 36 fasst die Autorin die vorher schon geäußerten Gedanken ihrer Figur über den Verlust des Birnbaums noch einmal in Form eines Gedichtes zusammen. Der Verlust des Baumes ging einher mit der Unverträglichkeit von Birnen. Bis zum Zeitpunkt ihrer Erinnerung daran. Jetzt kann sie wieder Birnen essen.
Brüche
Auf S. 51 dann die Vermutung, die später zur Gewissheit wird: Der Vater schlägt die Mutter. Der erste auftauchende Konflikt ist jedoch viel zu schnell wieder abgehandelt, wird zur Normalität, löst nur später, viel später, eine Aktion der Protagonistin aus. Es geht weiter mit unzähligen Partizipialkonstruktionen und Beschreibungen von Umbauten und Veränderungen. Ansonsten ist alles, was die Protagonistin auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden erlebt, allseits bekannt. Nichts, was nicht jeder von uns ähnlich erlebt hätte. Nichts, was durch die artifizielle manieristische Sprache gewönne.
Endlich, auf S. 58, explodiert die bürgerliche Wohlanständigkeit der Wirtschaftswunderjahre. Spät, viel zu spät, wird es interessant. Aber nur vorübergehend. Im ganzen Roman ist keine Entwicklung der Protagonistin zu finden, keine mit dem Älterwerden einhergehende Wandlung. Nur Aneinanderreihungen von Vorkommnissen.
Mein Fazit
Statt Beschreibungen von Tapeten- und Fliesenmustern, Um- und Ausbauten hätte ich mir von der Autorin gewünscht, die Figuren lebendiger zu gestalten, ihnen mehr Tiefe zu geben. So waren sie für mich nur Statisten in einem Haus, das am Schluss ebenso dem Verfall preisgegeben ist wie deren Bewohner.
Bea Dieker, Vaterhaus
Jung und Jung, Salzburg und Wien 2015
Online bestellen: https://www.buchhandel.de/buch/Vaterhaus-9783990270745
Autorin der Rezension: Cornelia Lotter
www.autorin-cornelia-lotter.de