Dass die Bandbreite an philosophischen Fachzeitschriften eine große ist, dürfte nicht wirklich überraschen. Schließlich soll es ja ziemlich exakt so viele Philosophien wie Philosophen unter der Sonne geben. Entsprechend „exklusiv“ beziffert sich dann auch die Auflage der meisten dieser Organe. Anders, nämlich eher überschaubar, zeigt sich das Angebot für populärphilosophische Magazine. Einer der Platzhirsche auf diesem Markt ist der französische Verleger Fabrice Gerschel. 2006 gründete er in Paris das heute vor allem in Frankreich sehr erfolgreiche Philosophie Magazin – die Idee dazu kam ihm übrigens am „sonnigen Strand auf Korsika“. Seit 2011 scheint und erscheint dieser Lichtblick für Weisheitsfreunde auch sechs Mal pro Jahr auf Deutsch: unter der Ägide von Chefredakteur Wolfram Eilenberger im Berliner Philomagazin Verlag und mit einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren pro Heft. Zudem erscheinen regelmäßig Sonderausgaben zu speziellen Themen. Die seit Januar 2015, und damit synchron zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, erhältliche Nummer 3 dieser Sonderhefte widmet sich dem Thema „Die Philosophen und der Nationalsozialismus“.
 Chefredakteurin dieser Extra-Edition ist die Berliner Autorin, Journalistin und Philosophin Catherine Newmark. Sie bzw. ihr Team hat bei diesem Themenkreis nicht zuletzt auch formal eine Zäsur zu den laufenden Ausgaben des „Philomag“ gesetzt. Statt „bunt und angenehm locker gestaltet“ die „Philosophie in unseren Alltag“ zu bringen (so der Anspruch des Verlags), herrscht hier nun schwarz-weiß Ästhetik vor – und ein an den Konstruktivismus erinnernder Einsatz von zumeist roten „Störern“. Das Farbklima der Nazis selbst bildet somit quasi das optische Grundrauschen des ganzen Hefts.
Chefredakteurin dieser Extra-Edition ist die Berliner Autorin, Journalistin und Philosophin Catherine Newmark. Sie bzw. ihr Team hat bei diesem Themenkreis nicht zuletzt auch formal eine Zäsur zu den laufenden Ausgaben des „Philomag“ gesetzt. Statt „bunt und angenehm locker gestaltet“ die „Philosophie in unseren Alltag“ zu bringen (so der Anspruch des Verlags), herrscht hier nun schwarz-weiß Ästhetik vor – und ein an den Konstruktivismus erinnernder Einsatz von zumeist roten „Störern“. Das Farbklima der Nazis selbst bildet somit quasi das optische Grundrauschen des ganzen Hefts.
Entscheidend freilich sind die Inhalte. Diese spannen über knapp 100 Seiten den ganz großen Bogen: von den philosophischen Ursprüngen der Grundbegriffe des nationalsozialistischen Denkens (z.B. der gründlich missverstandene Ausdruck „Arier“ von Joseph Arthur de Gobineau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts) über Betrachtungen zur „Idee der Volksgemeinschaft“ bis hin zu Fragen der Jüdischen Theologie nach der Shoah oder „Ausschwitz als Metapher der Moderne“. Selbstverständlich werden auch Nietzsche und ganz besonders Heidegger einer umfassenden Analyse unterzogen. Und weder Paul Celan, Hannah Arendt oder Adorno dürfen mit ihren oft zitierten Maximen und Werken fehlen (wie u.a. die „Todesfuge“ in voller Länge).
Erfährt man also wirklich Neues? Ja und nein… und vielleicht. Natürlich hängt die Höhe des Erkenntnisgewinns wie immer so auch hier vom Ausgangslevel des jeweiligen Lesers ab. Sehr gut recherchiert und aufbereitet sind eine ganze Reihe von historischen Quellen, wie etwa Karl Jaspers‘ Publikation zur „Schuldfrage“ oder die Rede von Thomas Mann „Deutsche Ansprache“ aus dem Jahr 1930. Und generell wird schnell klar, dass etwa Heidegger und Konsorten nur die Spitze eines Eisbergs an Wegbereitern oder -begleitern der Nazi-Ideologie waren. Viele Aspekte werden auch durch teils hochkarätige Interviews eingehend betrachtet. Unter anderem wäre hier das wirklich in die Tiefe gehende Gespräch mit Volker Gerhard (bis 2012 Mitglied des Deutschen Ethikrats) zum Thema „Der Wille zur Macht“ zu erwähnen. Vom Aufbau her naheliegend, aber letztlich eben auch sehr komfortabel fürs einordnende Verständnis: der Großteil aller Artikel und Dokumente ist in einen historisch-chronologischen Rapport eingebettet; mit den Kapiteln „Aufstieg der NSDAP“, „Machtergreifung“, „Kriegsjahre“ und – höchst interessant – „Unheimliche Kontinuität: NS-Philosophen in der BRD“. Es gab eben neben dem unsicheren Kantonisten und „antisemitischen Dauerläufer“ Heidegger auch nach dem Krieg weitere fragwürdige Sportsfreunde im Geiste – und in Amt und Würden. Etwa Hans-Georg Gadamer, Arnold Gehlen oder Hans Freyer, um nur einige zu nennen.
Fazit: Wer sich im Zusammenhang mit den anstehenden Gedenktagen die Frage stellt, ob und wie es sein kann, dass die „Liebe zur Weisheit“ auch zum Apologeten von Rassenwahn oder Kriegstreiberei werden kann, findet hier erste Antworten. Und eine Menge Tipps für weitere Nachforschungen in eigener Regie. Wer denkt, dass die Zeit der Nazis ein Zwischenspuk war und eigentlich „zum Vergessen“ ist, der kann nach der Lektüre dieses Sonderhefts zumindest für unsere Gegenwart eines gewinnen: nämlich den geschärften Blick auf die historische Kontinuität und den katastrophalen Impetus eines Denkens im radikalen Rahmen. Denn Intelligenz ohne Empathie war, ist und bleibt nun mal eine der verheerendsten Konstellationen, die das menschliche Gehirn zu bieten hat.
Rezension: Harald Wurst | ph1.de


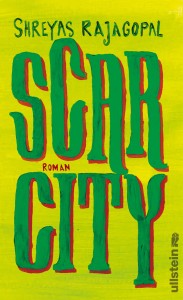

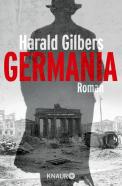
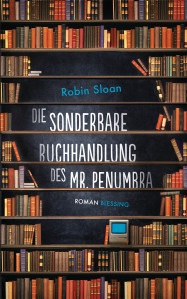

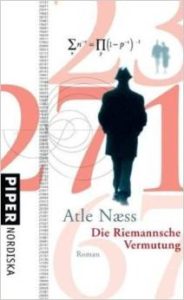 Voilà: Im Raum der reellen Zahlen ist eine negative Wurzel nicht definiert; denn Minus mal Minus ergibt immer Plus. Anders aber bei der Erweiterung hin zu den komplexen Zahlen. Und da wird dann die Wurzel aus (-1) ‚i‘ genannt. Damit ist, unter anderem nach Ansicht des Autors Atle Næss, die Welt ins Metaphysische hinein eröffnet. Und damit konnte Bernhard Riemann 1859 auch seine berühmte Vermutung aufstellen. In prosaischen Worten lautet diese: Man kann bei der Verteilung von Primzahlen im unendlichen Meer der natürlichen Zahlen gewisse versteckte Muster bei deren Auftauchen entschlüsseln. Auf diesem Fundament bastelt Næss nun seine Geschichte, die uns als Tagebuchaufzeichnungen des Mathematikdozenten Terje Huuse serviert wird.
Voilà: Im Raum der reellen Zahlen ist eine negative Wurzel nicht definiert; denn Minus mal Minus ergibt immer Plus. Anders aber bei der Erweiterung hin zu den komplexen Zahlen. Und da wird dann die Wurzel aus (-1) ‚i‘ genannt. Damit ist, unter anderem nach Ansicht des Autors Atle Næss, die Welt ins Metaphysische hinein eröffnet. Und damit konnte Bernhard Riemann 1859 auch seine berühmte Vermutung aufstellen. In prosaischen Worten lautet diese: Man kann bei der Verteilung von Primzahlen im unendlichen Meer der natürlichen Zahlen gewisse versteckte Muster bei deren Auftauchen entschlüsseln. Auf diesem Fundament bastelt Næss nun seine Geschichte, die uns als Tagebuchaufzeichnungen des Mathematikdozenten Terje Huuse serviert wird.